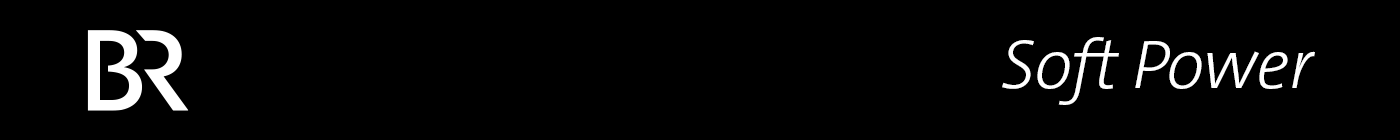 |
|
Hallo zusammen, |
|
eigentlich wollte ich in diesem Letter niemals über Social-Media-Viralitäten schreiben, die am nächsten Tag schon wieder vergessen sind. Was mich aber immer wieder fasziniert, sind die Irrwege der Nostalgie. Die sind hier schon öfter zur Sprache gekommen, etwa wenn es um das "bessere" Internet von früher ging. Vor ein paar Wochen habe ich hier auch schon einmal über KI-Fakes geschrieben, die angeblich das München der Neunziger zeigten. Obwohl auf den künstlich generierten Bildern gelbe Trambahnen herumfuhren, die es in München nie gab, kommentierten Menschen darunter, dass sie genau dieses gute alte München vermissten. In den vergangenen Wochen ist mir ein Trend begegnet, der auf eine andere Art eine Vergangenheit idealisiert, die es – zumindest in meiner Erinnerung – nie gab: Die Erzählung von der "millenial optimism era". Wurden die Millenials aus Perspektive der Generation Z bis eben noch als aus der Zeit gefallene Cringe-Objekte mit zu engen Hosen, Sneakersocken und verkitschtem Musikgeschmack gezeichnet, gilt die Zeit zwischen den späten Nuller- und frühen Zehnerjahren nun plötzlich als Sehnsuchtsort. Ich fürchte, dieser Ort ist genauso erfunden, wie die gelben Trambahnen in München. Hunderte Videos, die auf TikTok kursieren, feiern die vermeintliche "optimism era", die zeitlich nicht näher verortet wird, aber wohl irgendwann zwischen 2008 und 2016 stattgefunden haben soll. Zu sehen sind Fotos von damals hippen Menschen in New Yorker Stadtteilen Williamsburg und Bushwick. Sie sind ausnahmslos fröhlich, tragen Porkpie-Hüte, Ankle Boots und Hornbrillen, was natürlich auch gleich zur nachahmenswerten "Aesthetic" erklärt wird. Man könnte diesen Trend vorschnell folgendermaßen einordnen: Hier sehnt sich die Generation ab Mitte 30 nach ihrer faltenfreieren Jugend, ergänzt durch die gebeutelte Gen Z, die nun auch einsieht, dass die Zeit vor… – ja, vor was eigentlich? – irgendwie unbeschwerter war. Angesichts der Gemütslage der Millenials jener Ära bin ich aber skeptisch: Erinnerungen sind natürlich immer subjektiv, aber ich bin genau so ein Millenial, da sollte ich mich in der "optimism era" doch zumindest ansatzweise wiedererkennen, oder nicht? Was die Mode betrifft, stimmt natürlich vieles, aber vom angeblichen Optimismus jener Jahre habe ich nichts mitbekommen. Gerade in der Zeit nach der Finanzkrise sah vieles düster aus. Zufälligerweise war ich 2011 selbst für ein paar Tage im vermeintlich paradiesischen Williamsburg, wo mir die Leute anstatt grenzenlosen Optimismus auszustrahlen eher von den vierstelligen Monatsmieten für ihre WG-Zimmer erzählten. Die Millenials wurden in den Medien damals nicht gerade wohlwollend als faul, apolitisch und narzisstisch beschrieben. Der Irakkrieg und die schon damals knapp aufeinanderfolgenden Krisen hatten viele desillusioniert, die von Obama ausgehende Hoffnung auf bessere Zeiten verpuffte und im "magischen" Jahr 2016… nun ja, kam auch schon Trump an die Macht. Die Nostalgie bezieht sich hier also, finde ich zumindest, nicht auf eine objektiv optimistischere Grundstimmung. Mehr noch: Die angebliche "Era" wird heute bewusst inszeniert, um einen Kontrast zur heutigen Zeit zu generieren. Nostalgie kann positive Effekte haben, wenn etwa zu Unrecht in Vergessenheit geratene Dinge wieder an die Oberfläche kommen. Sie kann aber auch destruktiv wirken. In einem völlig anderen Kontext bin ich heute über die Worte des kanadischen Premierministers Mark Carney gestoßen, der in Bezug auf die Hoffnung auf die Rückkehr zu einer alten, geordneten Welt richtigerweise sagte: "Nostalgia is not a strategy". Bei den Empfehlungen bleiben wir diese Woche zunächst mal im Thema: Ich bin beim Recherchieren nämlich auf dieses BR-Feature von 2022 gestoßen, das sich ebenfalls kritisch mit Nostalgie auseinandersetzt. Die Autorin Justina Schreiber hat die Nostalgie von ihren Wurzeln in einer Schrift von 1688 bis heute verfolgt und zeigt, dass auch die Bedeutung des Begriffs selbst sich ständig gewandelt hat. Neben dem Millenial-Optimism-Kram sehe ich gerade sehr oft (und gerne!) Clips dieses Menschen namens Husk, der einen KI-Sprachbot mit maximal schrägen Fragen zu ebenso absurden Antworten treibt und dabei – ganz nebenbei – die begrenzte Anwendbarkeit von KI aufzeigt. Ich empfehle besonders "How AI reacts to me stuck in quicksand". Und weil es hier mittlerweile fast Tradition geworden ist, dass ich am Schluss einen, nun ja, abseitigen Musiktipp gebe, gibt es diese Woche christlichen Synth-Orgel-Pop, gesungen von einer australischen Nonne in den Siebzigerjahren! Ich meine das durchaus ernst: Die Gottesanbeterinnen-Songs von Sister Irene O'Connor, die zum Beispiel das "Vaterunser" über eine holprige Drummachine legt, haben bereits Künstler wie James Blake gesamplet. Jetzt ist ihr Album "Fire of God's Love" als Reissue beim New Yorker Label "Freedom to Spend" erschienen. Die christliche Botschaft geht im Reverb fast unter, vielleicht auch nicht so schlimm, Schwester O‘Connor klingt sowieso eher nach No-Wave-Avantgarde.
Bis nächste Woche!
|
|
|
Mehr Kultur
|
|

