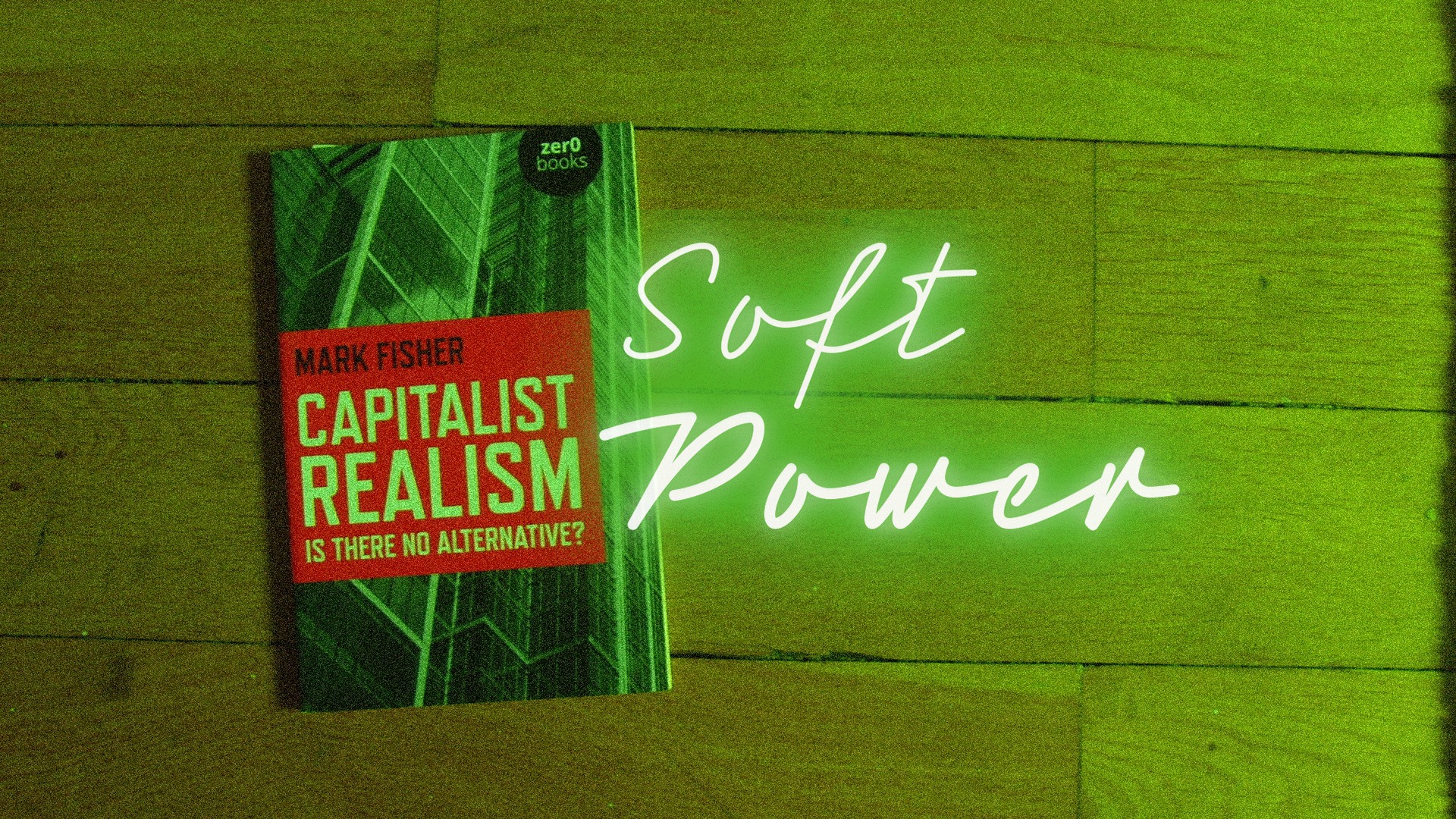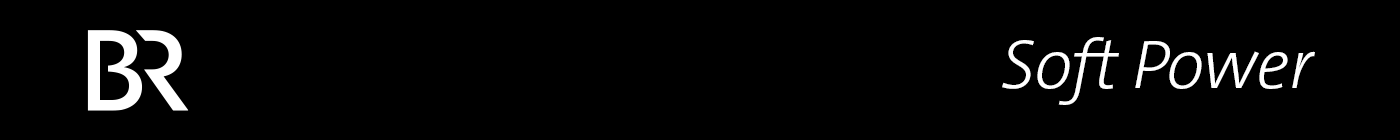 |
|
Hallo zusammen, |
|
heute geht es mal wieder um die Geister der Vergangenheit: derzeit stolpere ich beim Lesen nämlich wieder häufiger über den guten alten Mark Fisher. Fisher ist für viele, die über die schlimme Welt, das kaputte System und so weiter nachdenken, ein Vorbild: Mit seinem Blog k-punk und dem Klassiker "Capitalist Realism" schuf er in den Nullerjahren eine neue Form der linken, pop-inspirierten Gesellschaftsanalyse. Anstatt nur in Uralt-Diskursen herumzuwühlen, widmete er sich den neuen Verhältnissen, die das Internet, Smartphones und soziale Medien mit sich gebracht hatten. Natürlich bin auch ich ein Fisher-Fan. Besonders erbaulich ist er allerdings selten. Fisher hatte Depressionen, was er nicht versteckte oder als individuelles Leid beschrieb, sondern zum Teil seiner Systemkritik machte. Am bekanntesten aus Fishers Werk ist wohl die These, dass es uns heute leichter fällt, uns das Ende der Welt auszumalen als das Ende des Kapitalismus. Auch wenn der Spruch gerne Fisher selbst zugeschrieben wird, zitiert er hier den Literaturkritiker Fredric Jameson. Seine letzte, nie vollendete Vorlesungsreihe vor seinem Suizid 2017 handelte vom "postcapitalist desire" und der Frage, ob und wo es vielleicht doch eine Sehnsucht nach - oder vielleicht sogar eine konkrete Vorstellung - einer post-kapitalistischen Welt geben könnte. Man könnte sagen: Hier schien etwas Optimismus durch, die Möglichkeit eines Auswegs aus der nie endenden Wiederholung. Und auch in "Capitalist Realism" finden sich durchaus zukunftsgewandte Töne: Emanzipatorische Politik, und damit wohl auch kulturelle Erzeugnisse, müssten "den Anschein einer ‘natürlichen Ordnung’ zerstören und das als notwendig und unausweichlich Dargestellte als reine Kontingenz aufdecken." Ebenso müsse sie "als erreichbar sichtbar machen, was zuvor als unmöglich erschien", schreibt Fisher. Fisher-Leser und -Fans könnten diese positiven Gedanken heute weiterspinnen. Begegnen mir aber heute Texte, die sich an Fisher orientieren, passiert das aber leider meist im Kontext der Ausweglosigkeit. Fisher hatte in etwa in einem weniger nuancierten Text den Sound der Band Arctic Monkeys als Beispiel einer weltweit in Retromanie gefangenen Kultur herangezogen, einer Zeit der "aufgekündigten Zukunft", in der nichts Neues mehr entstehen könne. Ich fand es als Fan immer ein leicht enttäuschend, wie wenig er hier über seinen eigenen Tellerrand blicken konnte. Während die Indie-Briten ihre Gitarren nicht aus der Hand legen wollten, entstand in den späten Nullerjahren nämlich langsam das, was man heute die "multipolare Pop-Ordung" nennen könnte: Baile Funk aus Brasilien, erste Signale des K-Pop-Hypes oder südamerikanische Reggaeton-Hits in westlichen Charts waren Anzeichen genau solcher Veränderungen, die Fisher zu vermissen vorgab. Derzeit höre ich viel vom Buch "Blank Space" des US-Autors David Marx, erschienen im vergangenen November. Laut Titel hat er sich daran gemacht, eine "Kulturgeschichte des 21. Jahrhunderts" zu schreiben, also zumindest der ersten 25 Jahre. Das Buch ist lesenswert, es finden sich einige gute Gedanken zur neoliberalen Durchdringung der Kultur, ihrer Quantifizierung durch Like- und Streamingzahlen und den Irrwegen des "Poptimism"-Kritikertyps, der in jedem noch so auf Massengeschmack konzipierten Werk eine einzigartige Qualität entdecken wollte. Leider verfällt Marx dabei neben oft gut begründeter Wut auch in recht vorhersehbares Gemecker, das sehr an die schwächeren Momente von Fisher erinnert: Marx prognostiziert etwa, unser Jahrhundert werde "wahrscheinlich als das am wenigsten innovative, am wenigsten transformative und am wenigsten wegweisende Jahrhundert für die Kultur seit der Erfindung der Druckerpresse in die Geschichte eingehen". Vergleiche man etwa den Pop der vergangenen 25 Jahre mit den Jahrzehnten davor, werde das besonders deutlich. Damals sei noch alles toll gewesen: "Punk ersetzte Prog-Rock, Rap begrub Funk und Alternative eroberte Hair Metal und Synthpop", schreibt er. Früher seien beim Pop-Festival Lollapalooza die Alternativ-Grunger Pearl Jam aufgetreten, heute legt dort der CEO von Goldman Sachs auf. Diese plakativen Beispiele kommen natürlich gut an. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibt der Rezensent (€) zustimmend: "Kein Superstar der letzten 25 Jahre hat ästhetische Veränderungen angeregt", man solle sich doch nur mal die langweilige Taylor Swift anhören. Ich finde zwar auch, dass sich Superstars grundsätzlich mehr trauen sollten. Aber was ist denn zum Beispiel mit Kendrick Lamar, Bad Bunny oder Rosalía? Alles nur interpolierte Beatles-Songs, oder wie? Auch der von mir eigentlich geschätzte Autor Georg Diez schreibt in seinem Newsletter in Bezug auf Marx‘ Buch: "25 Jahre leben wir nun schon im 21. Jahrhundert, und kommen doch irgendwie nicht von der Stelle". Diesen Stillstand will er bei einem Besuch in München gespürt haben, in der Bar Schuhmann’s: "Da sitzen sie und räsonieren im Schumann’s wie eh und je", schreibt er, offenbar enttäuscht, dass dort nur Weggefährten von früher und nicht junge, revolutionäre Künstler rumsitzen. Ich will Freunden der Schumann’s-Bar nicht zu nahetreten, aber hier liegt glaube ich das Grundproblem des "Es gibt nichts Neues mehr"-Denkens: Es stammt oft von nicht mehr ganz jungen Menschen, die das Neue immer noch dort suchen, wo sie es Jahrzehnte vorher gefunden haben. Der Retromanie zu verfallen und Mark-Fisher-Thesen von 2009 aufzuwärmen, ist da fast schon ein Eingeständnis, dass einem selbst nichts Spannendes mehr einfällt. Und irgendwie hört die Welt immer genau dann auf spannend zu sein, wenn sich die eigene Jugend dem Ende zuneigt. Anstatt demonstrativ an der Gegenwart zu verzweifeln, könnte man erkennen, dass die Avantgarde jenseits der eigenen Gewohnheiten, der Schumann’s Bar oder Gitarrenbands liegt. Dass Kultur nicht in einer linear greifbaren "Auf X folgte Y"-Reihenfolge entsteht – und natürlich auch nicht nur im Westen. Man könnte nach Orten, Szenen und Stilen suchen, die sich außerhalb der Algorithmus-Ödnis, der einstudierten Debatten und ihrer bräsigen Austragungsorte verstecken. Und wer weiß, vielleicht fände man dort ja auch Mark Fishers "post-capitalist desire". Hier kommen die Empfehlungen für diese Woche, hoffentlich inklusive ästhetischer Veränderungen, trotz unseres bösen 21. Jahrhunderts: Bei der Suche nach neuer Musik lese ich in letzter Zeit immer sehr gerne den Newsletter "Infinite Speeds" von Vincent Jennewein. Größere Medien lassen elektronische, vor allem rein instrumentale Musik gern links liegen oder können sie jenseits von Phrasen wie "treibende Beats" und "wummernde Bässe" nicht einordnen. Jennewein hat eine angenehme Sprache für Sounds gefunden und wühlt sich durch die hunderten digitalen Neuerscheinungen, die einem von außen oft uferlos erscheinen. Über ihn bin ich neulich zum Beispiel auf emer aus Belgien gestoßen, die sehr angenehmen Dub-Ambient macht. In der ZDF-Mediathek gibt es gerade "I, Tonya" zu sehen. Der Film handelt von der Eiskunstläuferin Tonya Harding, so ziemlich das exakte Gegenteil der Klischee-Eisprinzessin. Harding kommt aus einem Alkoholiker-Haushalt, trägt eine eigenwillige Frizz-Dauerwelle und hat ständig Probleme mit Männern. Die werden noch größer, als ihr Ehemann einen Attentäter auf ihre größte Konkurrentin hetzt. Das Ganze basiert auf wahren Begebenheiten und ist eine Mischung aus Spielfilm und Mockumentary, bei der man nie genau weiß, ob man den Erzählern trauen kann. Und noch eine Art voreiliger Kinotipp: Der Film "O Agente Secreto" des Brasilianers Kleber Mendonça Filho, der von einem Verfolgten in der brasilianischen Militärdiktatur erzählt. Ich schaue mir ihn zwar selbst erst am Wochenende im Kino an, aber so viele "Musst du sehen!"-Empfehlungen habe ich in diesem Jahr noch nie bekommen. Oscar-nominiert ist er auch noch, und Filhos Vorgängerfilm "Bacurau" fand ich auch schon großartig. Sollte er mir wider Erwarten doch nicht gefallen, folgt hier nächste Woche ein Update. Bis dahin! |
|
|
|
Mehr Kultur
|
|